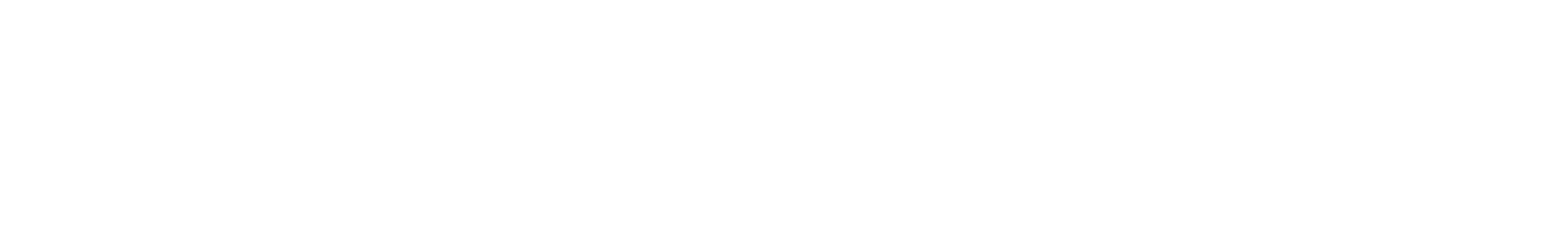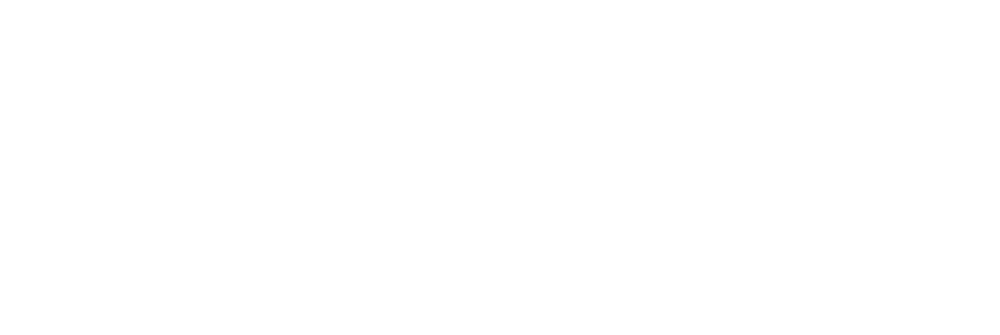Der 11. November 2000 hätte ein sonniger, unbeschwerter Skitag am Gletscher in Kaprun werden können – doch er endete mit dem Tod von 155 Menschen und der bis heute größten Seilbahnkatastrophe Europas.
Die verheerenden Ereignisse in der „Gletscherbahn Kaprun 2“ nehmen kurz nach neun Uhr morgens ihren Lauf, als eine nahezu vollbesetzte Garnitur der Standseilbahn die Talstation verlässt. Schon kurz nach der Abfahrt beginnt ein Heizlüfter im hinteren Teil des Zugs zu brennen. Der Brand beschädigt Leitungen der Bremshydraulik, weshalb der Zug etwa 600 Meter nach der Einfahrt in den 3,3 Kilometer langen Tunnel stoppt. Die Fahrgäste versuchen, sich aus dem brennenden Zug zu befreien, doch die Flucht und Rettung wird durch mehrere Faktoren erheblich erschwert. Von 162 Fahrgästen können sich nur zwölf durch Eigeninitiative retten, 150 Menschen finden den Tod. Weitere fünf Personen im Gegenzug und in der Bergstation sterben durch aufsteigende Rauchgase.
Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Welche Mängel traten bei den Brandschutz- und Sicherheitsvorkehrungen zutage – und warum wurden diese nicht früher erkannt? Handelt es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände, die so nicht vorhersehbar war, oder wäre der tödliche Vorfall vermeidbar gewesen?
Otto Widetschek hat sich mit Sicherheitskonzepten für Tunnelanlagen intensiv beschäftigt, so auch mit dem Hergang und den Folgen der Brandkatastrophe in Kaprun. Der Experte für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz war als Feuerwehroffizier selbst im praktischen Einsatz tätig und schafft als Gründer des Brandschutzforums Austria seit vielen Jahren Bewusstsein für betrieblichen Brandschutz.
Im Gespräch mit Gastgeber Werner Hoyer-Weber rekonstruiert er die fatale Ursachenkette und jahrelange Aufarbeitung des Unglücks. Im Fokus steht die Frage nach dem vorbeugenden Brandschutz: Welche Rolle spielte er im Jahr 2000, und wie haben sich die Richtlinien seither verändert?